Unbedingte Solidarität
Wie gelingt Solidarität auch ohne geteilte Erfahrungen und womöglich gar ohne gemeinsame Interessen?
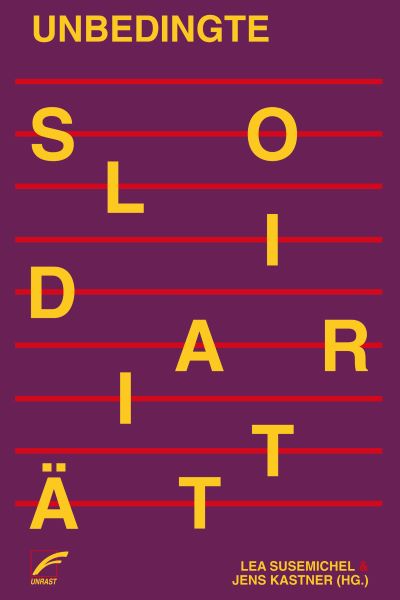
- Buch
- Susemichel, Lea; Kastner, Jens
- Unrast, 2025. - 312 Seiten
In den Jahren der Covid-19-Pandemie sei eine wahre „Diskurswucherung in Sachen Solidarität“ erfolgt, stellen Lea Susemichel und Jens Kastner in ihrer Einleitung fest und konstatieren die erwartbare Entwertung der Begrifflichkeit durch ihren inflationären Gebrauch. Im vorliegenden Sammelband plädieren sie – nicht zuletzt in Anschluss an die feministische Theoretikerin Diane Elam („groundless solidarity“) – für „unbedingte Solidarität“. Die Bedingungslosigkeit äußere sich dabei dreifach: Unbedingte Solidarität erfolge eben nicht als Schulterschluss bloß mit Gleichen, sondern finde gerade dort statt, wo sich Menschen mit Gruppen solidarisieren, mit denen sie keine geteilten Erfahrungen voraussetzen: „Unbedingte Solidarität beruht also auf Differenzen (und nicht auf Gleichheit), sie bedarf der Konflikte (und nicht der Konformität), sie hat mit Gefühlen zu tun (und nicht nur mit rationalen Entscheidungen).“ Zweitens sei sie unbedingt in dem Sinn, dass sie keine Gegenleistung erwarte und nicht an Bedingungen geknüpft werden dürfe. Schließlich sei sie drittens unbedingt notwendig, um globale Gerechtigkeit zu verwirklichen. Der Dringlichkeit dieses Anliegens verleihen die beiden Verfasser_innen mit diesem Band Ausdruck und geben dabei unterschiedlichen Perspektiven Raum. So sucht etwa ein Beitrag nach einem nicht-essenzialistischen Solidaritätskonzept und akzentuiert die Reziprozität solidarischer Beziehungen, während in einem späteren Beitrag davor gewarnt wird, beim Blick auf zumeist partikulare Bezugspunkte der Solidarität den inhärenten radikal-universalistischen Anspruch von Solidarität auszublenden. Andere Texte im vorliegenden teilen Erfahrungen aus der Geschichte der Arbeiter_innenbewegung, analysieren die neue Entwicklung des „Community-Kapitalismus“ oder zeigen am Beispiel der AIDS-Krise in den 1980er-Jahren, dass sich Solidarität nicht von selbst einstelle, sondern erkämpft und artikuliert werden müsse. Im Austausch mit konkreten Initiativen illustrieren die Herausgeber_innen die Kämpfe und konkreten Bedingungen von Solidarität, einerseits mit Interesse an der Kriminalisierung von Solidarität (zu Wort kommen die NGOs „Sea-Watch“ und „medico international“), andererseits mit Fokus auf Zeitschriftenredaktionen im deutschsprachigen Raum („Frauen*solidarität“, „Informationsstelle Lateinamerika“ (ila), „Informationszentrum Dritte Welt“ (iz3w) und „Lateinamerika-Nachrichten“). In dieser Zusammenstellung erinnert der Band „Unbedingte Solidarität“ kraftvoll daran, „dass Solidarität keine karitative Beziehungsweise ist. Sie verträgt sich nicht mit der hierarchischen Einseitigkeit des Paternalismus. Solidarität ist in Vergangenheit und Gegenwart eine bereits machbare Erfahrung. Sie ist zugleich ein Verlangen danach, alle Verhältnisse umzustürzen, die ein solidarisches Leben für alle verunmöglichen.“