Solidarität heute
Modeerscheinung oder nachhaltiger Gesellschaftswandel?
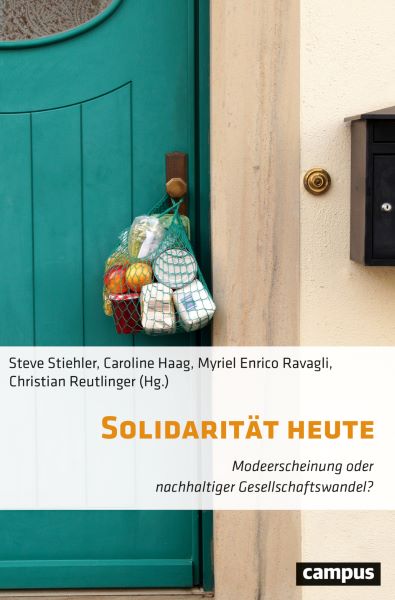
- Buch
- Stiehler, Steve
- Campus, 2023. - 234 Seiten
Bis vor wenigen Jahren sei der Solidaritätsbegriff in zeitgenössischen Kontexten vorrangig anlassbezogen in Reaktion auf humanitäre Katastrophen und Notstände aufgerufen bzw. für die Organisation karitativer Aktionen verwendet worden. Immanent zeugte dieser Gebrauch von der Auffassung, dass Solidarität (zumindest im Globalen Norden) angesichts gut ausgebauter Sozialsysteme lediglich in Ausnahmefällen und Notsituationen erforderlich sei. Die gesellschaftskritische und politische Tradition des Begriffs schien dagegen verstaubt zu sein: „Auf Solidarität als permanente (Auf)Forderung rekurrierten nur noch bestimmte Gruppen und Parteien, welche sich auf die historische Bedeutung des Solidaritätsbegriffs bezogen: auf die Arbeiter:innensolidarität und die Tradition der Sozialen Frage industriekapitalistischer Prägung, die das gesellschaftlich erzeugte, individuelle Leid anprangerte.“ Mit den multiplen globalen Krisenlagen (jüngst etwa der Corona-Pandemie oder dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine) hat der Solidaritätsbegriff jedoch neue Dynamik erhalten und erfreut sich in unterschiedlichsten Milieus seiner neuen Konjunktur. Ein gemeinsames Verständnis ist dabei jedoch schwer auszumachen, die Konnotationen und Intentionen der eingesetzten Begrifflichkeit divergieren und können bisweilen Widersprüchlichkeiten erzeugen. Gleichzeitig sei der Begriff nicht unbedingt beliebig, sondern enthalte ein Grundmaß an feststehenden Inhalten. Die Herausgeber_innen plädieren insofern dafür, den Solidaritätsbegriff als „Grenzobjekt“ zu verstehen: Dieses soziologische Konzept adressiert Informationen, die sowohl flexible Verwendungen und Interpretationsspielräume für unterschiedlichste Akteur_innen zulassen, als aber durch einen robusten Anteil unveränderlicher Inhalte eine Identität bewahren. Ziel des vorliegenden Sammelbandes ist es, dieser Vielgestalt von Solidarität nachzugehen, unterschiedliche Perspektiven sowie Praktiken zu beleuchten und Bedingungen tragfähiger Solidarität zu diskutieren. Die Beiträge des Sammelbandes sind dabei grob in drei Abschnitte gegliedert, wobei sich der erste mit Aspekten der „Vergewisserung und Revitalisierung“ aus unterschiedlichen (v.a. auch historischen und ideengeschichtlichen) Blickwinkeln auseinandersetzt. Im zweiten Abschnitt stehen unter dem Titel „De- und Rekonstruktion von Solidarität“ kritische Positionierungen im Zentrum, die unterschiedliche Implikationen und Ausformungen von Solidarität problematisieren, Solidarität allerdings nicht rundheraus ablehnen, sondern wieder fruchtbar machen. Versammelt sind an dieser Stelle etwa feministische und postkoloniale Perspektiven oder ein Beitrag zu radikalen solidarischen Praktiken gegen Racial Profiling. Die Beiträge des dritten Abschnitts befassen sich schließlich mit Fragen der Realisierung und Praktizierung von Solidarität bzw. förderlichen und hemmenden Faktoren für deren Gelingen. Behandelt werden u.a. zentrale Herausforderungen für transnationales solidarisches Handeln, neoliberalen Fehlentwicklungen bzw. solidarischen Gegenentwürfen und den Deutungsangeboten von (Schweizer) Gewerkschaften für eine solidarische Bewältigung der Covid-19-Pandemie.