Rechte der Natur
Eine rechtsvergleichende Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Rechte von Flüssen
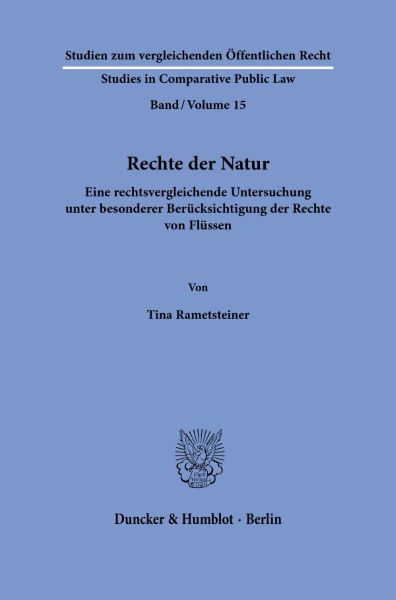
- Buch
- Rametsteiner, Tina
- Duncker & Humblot, 2025. - 511 Seiten
Angesichts der Klimakrise und des voranschreitenden Biodiversitätsverlusts mehren sich Stimmen, die dem Umweltrecht in seiner derzeitigen Form die Fähigkeit absprechen, mit diesen Herausforderungen angemessen umzugehen. Aus einer philosophischen Perspektive könne man abstrahieren, dass dies auch an einem gängigen anthropozentrischen Verständnis von „Menschheit“ liege, das diese nicht als Teil der planetaren Welt konzipiere, sondern zwischen Mensch und Natur und in weiterer Abstufung zwischen Lebewesen und leblosen Akteuren unterscheide: „Die größte Herausforderung unserer Zeit wird daher auch darin gesehen, die wissenschaftlichen Entdeckungen über »unsere Beziehung zur Welt« hinzunehmen und unsere Handlungen danach auszurichten.“ So gibt es etwa seit einigen Jahrzehnten rechtswissenschaftliche Überlegungen, die Natur nicht nur als Rechtsobjekt zu behandeln, sondern als Subjekt mit eigenen Rechten zu fassen. Diese Konzeptionen gründen auch zentral auf indigenen Perspektiven und hielten in jüngerer Vergangenheit bereits Einzug in einzelne Rechtsordnungen.
Tina Rametsteiner befasst sich in ihrer Dissertation mit solchen „Rechten der Natur“ nicht rein aus theoretischer oder rechtsphilosophischer Perspektive, sondern vergleicht konkrete Beispiele mit Fokus auf die Rechte von Flüssen und unternimmt daran anschließend den Versuch einer Synthese. Von den bislang 14 bekannten nationalen Beispielen, in denen Rechte der Natur in Rechtsvorschriften oder Gerichtsentscheidungen Anerkennung fanden, wählt Rametsteiner fünf Länder als Gegenstand ihrer Untersuchung aus, welche die vielfältigen Ausgestaltungen und ihre jeweiligen Implikationen verdeutlichen. Neben den Vereinigten Staaten von Amerika, in denen Rechte der Natur zuerst anerkannt wurden, befasst sich die Rechtswissenschaftlerin mit Ecuador, Bolivien, Kolumbien und Neuseeland. Systematisch arbeitet sie dabei stets Kontext und Genese heraus, erörtert Rechtsquellen, Rechtsträger_innen und konkrete Rechte, bevor sie anschließend die Zulässigkeit von Eingriffen diskutiert, Vertretungsbefugnisse klärt, Durchsetzungsmöglichkeiten auslotet und abschließend eine Bewertung der Rechtswirklichkeit vornimmt. Dieser Struktur folgt Rametsteiner auch im zweiten Teil ihrer Untersuchung, in dem sie rechtsvergleichend arbeitet und nicht nur Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten der behandelten Beispiele akzentuiert, sondern auch mögliche Ableitungen für das österreichische Rechtssystem erarbeitet. So könnte eine grundrechtliche Absicherung der Rechte der Natur deren formelle Durchsetzbarkeit vollständig gewährleisten, ein anderer Vorteil liege in der veränderten Perspektive: „Denn der Blick auf das Rechtssystem aus der Perspektive eines Ökosystems oder einer ähnlichen Organisationsebene der Natur- wie z.B. einem Wassereinzugsgebiet – macht ersichtlich, dass dessen Schutz nach der geltenden Rechtslage nur in bestimmten Kompetenzbereichen, bei bestimten Tätigkeiten, von bestimmten Personen oder Behörden unter bestimmten Voraussetzungen zu berücksichtigen ist, sofern keine Ausnahme anwendbar ist. RdN [Rechte der Natur, Anm.] können daher Lücken im Recht schließen, die nicht auf das Umweltverwaltungsrecht beschränkt sind, sondern zumindest auch »das Verfassungsrecht und das Wirtschaftsverwaltungsrecht« betreffen.“
Über die sorgfältige Auseinandersetzung mit konkreten Rechtsordnungen hinaus gewährt Rametsteiners Dissertation wichtige allgemeine Erkenntnisse zur Materie: So werden wichtige epistemische und kosmologische Grundlagen der „Earth jurisprudence“ erkennbar, freilich auch die Heterogenität und Diffusität zentraler Begrifflichkeiten, die bislang kaum harmonisiert wurden. Wenngleich es noch zu früh sei, um die Auswirkungen dieser neuen Rechtsordnungen verlässlich einschätzen zu können, so verspreche die globale voranschreitende Entwicklung der Rechte der Natur nicht nur besseren Schutz der planetaren Grundlagen an sich, sondern vermöge auch – um abschließend den Bogen zurück zur anthropozentrischen Verfasstheit gegenwärtiger Rechtsauffassungen zu schlagen – eine neue Garantie der Menschenrechte.