Nachhaltige Entwicklung und Menschenrechte in EU-Handelsabkommen
Untersuchung werteorientierter Ansätze in der vertraglichen Handelspolitik der EU am Beispiel des EU-Handelsabkommens mit Kolumbien und Peru
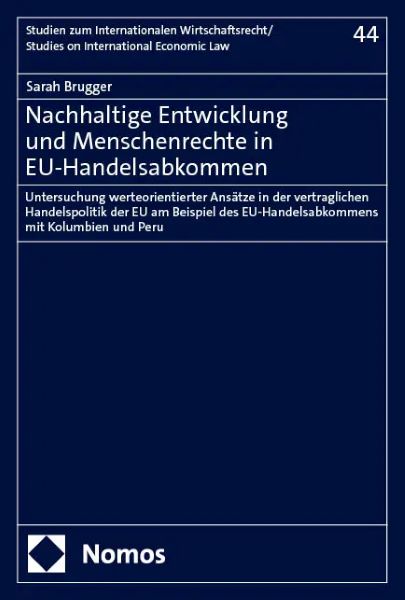
- Buch
- Brugger, Sarah
- Nomos, 2025. - 292 Seiten
Internationaler Handel steht in direktem Zusammenhang mit Lebensbedingungen und Entwicklungschancen im Globalen Süden. Die Politik sowie die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit globalen Wertschöpfungsketten müssen sich daher auch mit Problemlagen wie ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen, Menschenrechtsverletzungen oder Umweltverschmutzung befassen. Insbesondere stehen Handelsabkommen in der Kritik, die Externalisierung sozialer sowie ökologischer Kosten zu begünstigen und die Einhaltung von Mindeststandards zu unterlaufen. Dieser Kritik begegnen manche Akteur_innen seit einigen Jahren mit der Verankerung von Grundsätzen wie den Menschenrechten oder nachhaltiger Entwicklung in neuen Abkommen. Sarah Brugger setzt sich in ihrer rechtswissenschaftlichen Dissertation mit diesem normativen Ansatz anhand der europäischen Handelspolitik auseinander. Hierfür werden zunächst Grundlagen vorgestellt: Nach einer Einführung in die Genese der Welthandelsordnung nach 1945 wird skizziert, wie normative Grundprinzipien der internationalen Gemeinschaft (etwa im Bereich des Menschenrechtsschutzes, von Arbeitsstandards oder globaler Umweltabkommen) schrittweise Einzug in die Handelspolitik gehalten haben. Anschließend fokussiert Brugger auf die europäische Handelspolitik im Speziellen, wobei sie im Vertrag von Lissabon die zentrale Rechtsgrundlage für die normative Orientierung der EU-Handelsabkommen erkennt. Im dritten Teil konkretisiert die Verfasserin diese normative Dimension und identifiziert zwei wesentliche Instrumente, namentlich die Menschenrechtsklausel sowie die Kapitel zu Handel und nachhaltiger Entwicklung. Während letztere auf die Förderung etwa von Arbeits- und Umweltstandards und insgesamt den Aufbau von Partnerschaft im Sinne nachhaltiger Entwicklung abzielen, dienen die Menschenrechtsklauseln als „Schutzmechanismus“, um Vertragsparteien im Fall schwerwiegender Verstöße Handlungs- und Sanktionsspielräume zu eröffnen. Im vierten Kapitel wird diese Materie anhand eines Beispiels veranschaulicht: Das Handelsabkommen der EU mit den Staaten der Andengemeinschaft Peru und Kolumbien stellt einen der ersten Vertragstexte der normativen EU-Handelspolitik dar. Seit 2013 in Kraft (seit 2017 auch für Ecuador vorläufig gültig), erlaubt dieses außerdem, erste Auswirkungen zu resümieren. Dabei untersucht Brugger insbesondere die praktische Umsetzung in den Bereichen Biodiversität, Gewerkschaftsrechte, Fischerei und Klimaschutz. In diesem Zusammenhang zeigt sie mehrere Herausforderungen für die Andenstaaten selbst, aber auch für die Europäische Union auf, sieht in erheblichen Interpretationsspielräumen und unverbindlichen Zielsetzungen zentrale Schwachstellen, erkennt aber auch teilweise deutliche Fortschritte. Ein komparativer Exkurs in werteorientierte Ansätze der Handelspolitiken Kanadas, der USA und der Schweiz erkennt in der Menschenrechtsklausel schließlich ein Alleinstellungsmerkmal der EU-Handelspolitik. Gleichzeitig weist Brugger darauf hin, dass eben dieses Instrument (wie auch andere Sanktionsmechanismen) in der Vergangenheit kaum genutzt wurde. Möchte die EU ihre selbstauferlegten Ziele im Bereich des Menschenrechtsschutzes oder der Klimawandelbekämpfung erreichen sowie als glaubwürdiger Handelspartner wahrgenommen werden, müsse sie stringenter und ambitionierter agieren. Mit transparenten Verfahren, der Einbindung von Stakeholder_innen oder der Unterstützung des zuständigen Europäischen Auswärtigen Dienstes durch die Botschaften der Mitgliedsstaaten formuliert die Juristin abschließend Handlungsempfehlungen, um die Lücken bei der praktischen Umsetzung normativer Handelspolitik zu schließen.