Grüner Kolonialismus
Zwischen Energiewende und globaler Gerechtigkeit
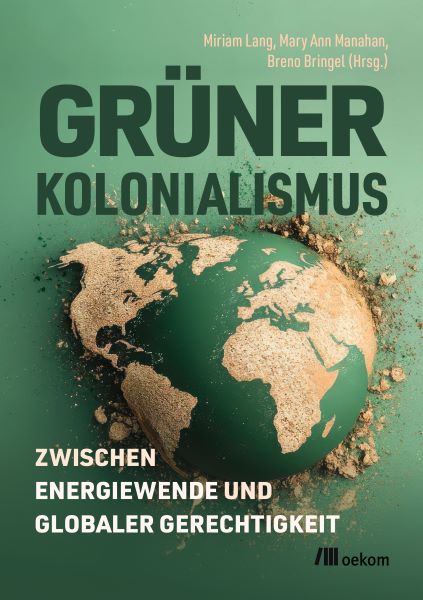
- Buch
- Miriam Lang u.a. (Hrsg.)
- Oekom, 2025. - 334 Seiten
Die Klimakrise manifestiert sich bereits seit Jahrzehnten in vielen verschiedenen Extremereignissen, rezente Entwicklungen wie die zunehmende Erosion der Weltordnung, die Covid-19-Pandemie oder der russische Angriffskrieg auf die Ukraine verschärfen die Dynamik zusätzlich. Der Dringlichkeit dieser Herausforderungen begegnen politische Akteur_innen mit Strategien und Unternehmungen ungeahnter Dimension. Doch sind die Energiewende, der „Green Deal“ und ähnliche Transformationsprojekte tatsächlich nachhaltig – und gerecht? Mitnichten, kommen die Herausgeber_innen schnell zum Kernargument ihres Sammelbandes: Als „Dekarbonisierungskonsens“ bezeichnen sie die zunehmende Elektrifizierung und Digitalisierung einer vormals primär von fossilen Ressourcen befeuerten Produktions- und Lebensweise. „Doch statt den Planeten zu schützen, trägt er [dieser Konsens, Anm.] zu seiner Zerstörung bei, vertieft bestehende Ungleichheiten, verschärft die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und hält das Modell der Kommodifizierung der Natur aufrecht.“ So suggeriere dieser Konsens die Möglichkeit eines „Weiter wie bisher“, solange nur auf erneuerbare Energien umgestellt würde und akzentuiere die kapitalistischen Potenziale eines grünen Wachstums. Leidtragende wären Regionen und Bevölkerungen des Globalen Südens, die sich mit den fundamentalen Auswirkungen eines „grünen Kolonialismus“ konfrontiert sehen: „In den ecuadorianischen Tropenwäldern wird die Abholzung durch die chinesische Nachfrage nach dem extrem leichten Balsaholz vorangetrieben, das für den Bau von Windturbinen verwendet wird. In Südafrika werden riesige Infrastrukturen für Wasserstoffkraftwerke für den Export von »sauberer« Energie zu einem Problem für Gemeinden, die ihren Lebensunterhalt mit kleiner Fischerei oder Landwirtschaft bestreiten. Im Maghreb verlieren Viehzüchter ihr Land und ihr Wasser an riesige Solarfarmen, die gebaut werden, um »grüne Energie« nach Europa zu liefern. Im südamerikanischen Lithiumdreieck kämpfen indigene Gemeinschaften um die knappen Wasserquellen, die zunehmend vom Lithiumabbau in Beschlag genommen werden, um alle Elektroautos mit Lithiumbatterien auszustatten.“
Der vorliegende Sammelband formuliert insofern den Anspruch, Gegenpositionen zum Dekarbonisierungskonsens einzunehmen und marginalisierte Stimmen aus intersektionaler und internationalistischer Perspektive sichtbar zu machen. Hierzu vereint er Beiträge von Personen, die wissenschaftliche wie aktivistisch tätig sind und mehrheitlich in Ländern des Globalen Südens beheimatet bzw. tätig sind. Diese Beiträge gliedern sich in drei Bereiche, wobei der erste Abschnitt der Analyse der Energiewende gewidmet ist. Hier stehen konkrete Prozesse der Aneignung und kapitalistischen Akkumulation ebenso im Vordergrund wie jene epistemischen und ideologischen Grundlagen, welche die Kolonialität des Dekarbonisierungshegemons begründen. Im zweiten Abschnitt werden jene globalen Machtverhältnisse beleuchtet, die den grünen Kolonialismus ermöglichen, als auch durch diesen fortgeschrieben werden, etwa ungleiche Handelsbeziehungen, Verschuldungsdynamiken oder Asymmetrien des Multilateralismus. Der dritte Abschnitt wagt schließlich einen Ausblick auf alternative Zukünfte, berücksichtigt werden etwa feministische Degrowth-Perspektiven, ein ökoterritorialer Internationalismus oder soziale Bewegungen im Bereich der Ernährungssouveränität. Durch diese Zusammenstellung gelingt „Grüner Kolonialismus“ eine kritische Politische Ökonomie der Energiewende, welche die vielen Ebenen der globalen Dynamiken herausarbeitet und miteinander verknüpft. Vorstellbar werden solcherart mögliche Bündnisse und Allianzen zur Verwirklichung globaler Gerechtigkeit, als auch die Unumgänglichkeit radikaler Veränderungen.