Europäische Außenpolitik
die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union im Spannungsfeld zwischen politischem Reformbedarf und mitgliedstaatlicher Souveränität
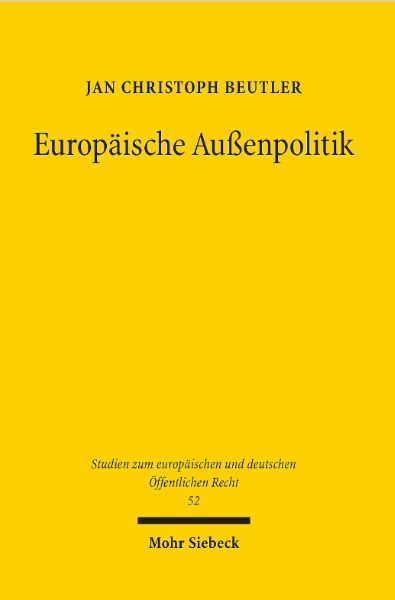
- Buch
- Beutler, Jan Christoph
- Mohr Siebeck, 2025. - 430 Seiten
Befasse man sich mit politischen wie auch wissenschaftlichen Diskursen zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU (GASP), so könne man sich des Eindrucks nicht erwehren, es handle sich bei dieser um „das Andere“ im europäischen Integrationsprozess oder gar um die „Achillesferse“ der Union: „Wird mit einem Verweis auf einen intergouvernementalen Charakter der GASP zugleich die Ursache für die Schwäche der Union im außenpolitischen Auftreten ausgemacht, so entsteht der Eindruck, die Staats- und Regierungschefs hätten es in Lissabon der Mutter des Achilleus gleichgetan und die Union in das schützende Wasser der Supranationalität getaucht, festgehalten an der Ferse der GASP. Die infolgedessen »hinkende Macht« kann so weder den Erwartungen an eine Union als wirtschaftliche und politische »Supermacht« gerecht werden, noch dem vielfachen Wunsch in der Bevölkerung nach einer europäisch geführten Außen- und Sicherheitspolitik nachkommen.“ Sei es in Bezug auf Sanktionen gegen Russland, die Politikkohärenz der europäischen Entwicklungszusammenarbeit oder eine gemeinsame Position zum Krieg in Gaza – die Defizite der GASP manifestieren sich regelmäßig. Für das Scheitern verschiedener Initiativen zur Stärkung der GASP werden zumeist die nationalstaatlichen Regierungen verantwortlich gemacht, gerade in jüngerer Zeit erschwere das Erstarken rechtspopulistischer Akteur_innen entsprechende Vorstöße. Argumente nationalstaatlicher Souveränität spielen dabei ebenso eine Rolle wie das symbolische Kapital des Profilierungsfeldes Außenpolitik. Jan Christoph Beutler befasst sich in seiner juristischen Dissertation mit diesem Spannungsverhältnis und untersucht, wie Reformansätze mit staatlicher Souveränität vereinbart werden könnten. Dabei formuliert er auch den Anspruch, Grenzen dieser Vereinbarkeit zu identifizieren, welche im weiteren Verlauf der Diskussion als Rahmen des (außenpolitischen) europäischen Integrationsprozesses fungieren könnten. In den ersten beiden Kapiteln diskutiert Beutler Grundlagen und die Genese europäischer Integrationsbemühungen im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik, wobei bereits Kontinuitäten von Konflikten und Streitpunkten erkennbar werden. Ausgehend vom Vertrag von Lissabon befasst sich der Autor anschließend mit der rechtlichen Ausgestaltung der GASP im Unionsrecht. Im dritten Kapitel wird dann der Schlüsselbegriff der Fragestellung adressiert: Der Souveränitätsbegriff wird in unterschiedlichen Dimensionen vor dem Hintergrund der europäischen Integration betrachtet und das jeweilige Verhältnis zu Außenpolitik diskutiert. Insbesondere setzt sich Beutler mit der Souveränitätskonzeption des deutschen Bundesverfassungsgerichts auseinander, um Eckpunkte einer Vereinbarkeit von staatlicher Souveränität und außen- bzw. sicherheitspolitischer Integration aus Perspektive der deutschen Verfassung zu formulieren. Anschließend vergleicht er die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts mit den entsprechenden Ansichten von Verfassungsgerichten in den Mitgliedsstaaten Frankreich, Lettland, Polen und Tschechien. Die Anwendung des dabei für den weiteren Verlauf gewonnene Souveränitätsverständnisses auf konkrete Reformvorschläge erfolgt im vierten und letzten Kapitel. Zu den diskutierten Maßnahmen zählen etwa die Vergemeinschaftung außenpolitischer Kompetenz, die Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen (also die Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip) oder die Erweiterung der Zuständigkeit des Gerichtshofs der EU. Im Angesicht seiner Erkenntnisse zieht Beutler schließlich ein verhaltenes Resümee, denn bleibe der Staat auf absehbarer Zeit der zentrale Akteur im Völkerrecht als auch im europäischen Integrationsprozess. Speziell im außenpolitischen Bereich spielten geografische und historische Spezifika eine große Rolle, unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse und der Wunsch nach Handlungsfreiheit hätten den Souveränitätsbegriff massiv aufgeladen. Schlussendlich spiegle die schwierige Stellung der GASP nichts weniger als die besondere Bedeutung von Außenpolitik sowohl für staatliche Souveränität als auch finale europäische Integration wider – ein Dilemma, dessen Auflösung in naher Zukunft nicht greifbar scheint.