Der Freihandel hat fertig
Wie die neue Welt(un)ordnung unseren Wohlstand gefährdet
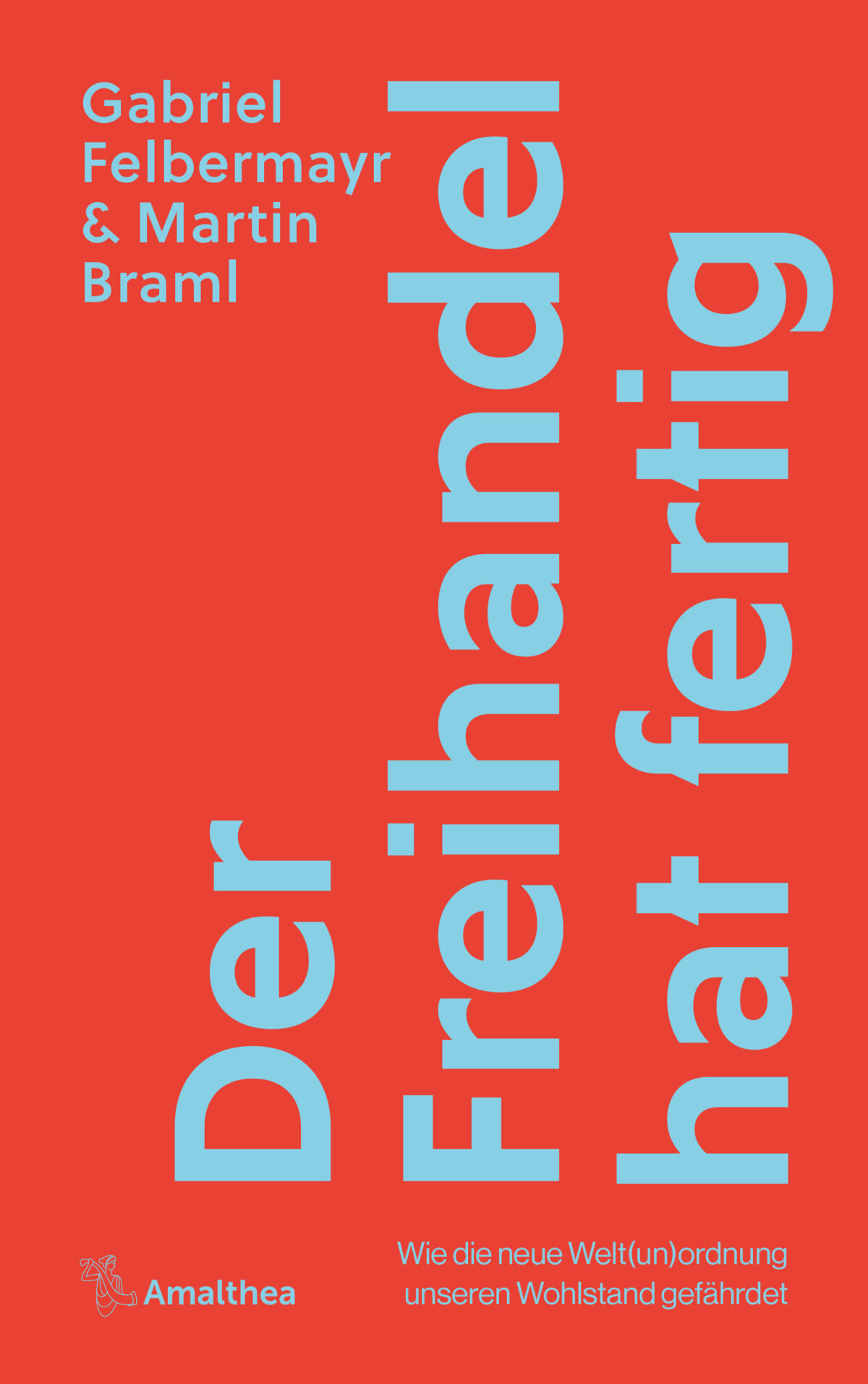
- Buch
- Felbermayr, Gabriel; Braml, Martin
- Amalthea, 2024. - 272 Seiten
In der ersten Präsidentschaft Donald Trumps erkennen die Autoren eine Abkehr von einer fast dreißigjährigen Periode des Freihandels, wenngleich sie dessen Administration weniger als Zäsur, denn als Katalysator für teils parallele Entwicklungen verstehen. Im Zuge von Brexit, Covid-19-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine traten Abhängigkeiten und vulnerable Positionen in Lieferketten deutlich zu Tage, ehemalige Verfechter des Freihandels setzen nunmehr protektionistische Maßnahmen und entfernen sich von Globalisierung und wirtschaftlicher Integration. Die beiden Ökonomen Gabriel Felbermayr und Martin Braml rufen eine grundsätzliche Vorteilhaftigkeit des Freihandels in Erinnerung, nehmen in „Der Freihandel hat fertig“ jedoch differenzierte Perspektiven ein. In einem kurzen ideengeschichtlichen Abriss kennzeichnen sie die Globalisierung als dynamisches Projekt, das unterschiedliche Konjunkturen durchlief und keine lineare Entwicklung nahm. Insofern nehmen sie die gegenwärtige „Welt(un)ordnung“ zum Anlass, über neue Notwendigkeiten und insbesondere Sicherheitsbedenken nachzudenken. Referenzpunkt dieser Souveränitätsüberlegungen sei dabei jedoch nicht der Nationalstaat, sondern Europa bzw. im erweiterten Sinn seine demokratischen Partner. In kompakten Kapiteln setzten sich die beiden Autoren mit Reformbedarf der WTO auseinander, beschäftigen sich mit Trumps Handelskriegen, positiven Externalitäten von zunehmendem Handel oder der Bedeutung von Auslandsinvestitionen und stellen die Frage, wie Freihandel und sozial-ökologische Nachhaltigkeit unter einen Hut gebracht werden können. Abschließend resümieren Felbermayr und Braml, dass es den idealtypischen Freihandel in realiter nicht gebe, dieser jedoch ein Ende eines Spektrums darstelle, an dessen anderem Ende die volkswirtschaftliche Autarkie stehe. Beide erwarten, dass der wirtschaftliche Austausch auf absehbare Zeit unfreier werden und die globale Wirtschaftspolitik zunehmend von machtpolitischem Nationalprotektionismus geprägt sein dürfte. Kritisch beäugen sie dabei jüngere Phänomene wie Lieferkettengesetze, Klimazölle oder Projekte einer „strategischen Industriepolitik“. Dabei stünde mittlerweile außer Frage, „dass die nationale Souveränität auch ein wirtschaftspolitisches Ziel sein sollte und handelspolitische Erpressbarkeiten vermieden werden müssen, selbst wenn solche Überlegungen im wissenschaftlichen Diskurs in den letzten Jahrzehnten sträflich vernachlässigt wurden“. Unter strengen Bedingungen seien hierfür auch Markteingriffe denkbar, grundsätzlich wird jedoch für marktnahe Ansätze plädiert. Felbermayr und Braml reflektieren zu guter Letzt, gegenüber Forderungen nach Handelsliberalisierungen skeptischer geworden zu sein, sehen in marktwirtschaftlichen Demokratien jedoch nach wie vor wenig Grund, wirtschaftlichen Austausch zu limitieren. Auch in der neuen Weltordnung und in direkter Konkurrenz zu autoritären Mächten gelte es, die „Strahlkraft unseres Systems, bestehend aus Demokratie, Rechtsstaat und Marktwirtschaft“ nicht zu unterschätzen.