Brennende Erde
Eine Geschichte der letzten 500 Jahre
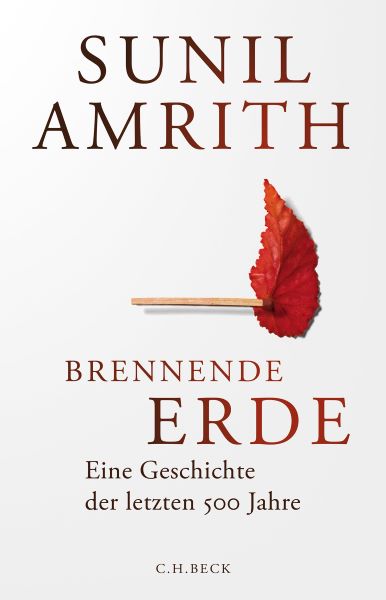
- Buch
- Amrith, Sunil
- C.H. Beck, 2025. - 505 Seiten
„Irgendwann einmal war alle Geschichte Umweltgeschichte“, leitet der Historiker Sunil Amrith seinen Band „Brennende Erde“ mit Verweis auf die unmittelbare Abhängigkeit der menschlichen Existenz von Natureinflüssen und planetaren Gegebenheiten ein: Die längste Zeit sah sich die Menschheit vielfältigen Risiken von Dürren, Hungersnöten, Pandemien und wilden Tieren ausgesetzt, von Generationen mühsam erworbener Wohlstand konnte mit einem Schlag ebenso dahin sein wie das eigene Leben in jungen Jahren. Doch irgendwann änderte sich diese Beziehung, natürliche Grenzen schienen zunehmend überwindbar und die Inwertsetzung der Ressourcen schritt immer schneller voran: „Die Mächtigsten in der Welt glaubten, und einige tun das auch heute noch, dass Menschen und andere Lebensformen auf der Erde nur Ressourcen sind, die dazu da sind, ausgebeutet zu werden, sie nach Belieben umherzuschieben.“ Während der Titel „Brennende Erde“ deutlich auf den gegenwärtigen planetaren Notstand referenziert, interessiert sich Amrith eigentlich historisch für jene Pfade, auf denen die Menschheit scheinbar die natürlichen Grenzen überwunden und sich von jahrtausendealten Abhängigkeiten befreit habe. Die Motivation für diesen Blick in den Rückspiegel der Umweltgeschichte: „Um noch irgendeine Hoffnung zu haben, das dicht gewobene Geflecht von Ungleichheit, Gewalt und Umweltzerstörung zu lösen, müssen wir seine Ursprünge verstehen.“
Dieses Unterfangen gelingt dem Professor an der Yale University mit einer nuancierten Erzählweise und einem globalen Panorama, das nicht bloß bekannte Zentren der industriellen Moderne als Schauplätze wählt, sondern historisch als auch regional ausholt und periphere Perspektiven berücksichtigt. So antizipiert Amrith mit einem Bericht über den Austausch des mongolischen Reiches spätere Expansionen, diskutiert Gewalt an Mensch und Natur als Motor der kolonialen Plantagenwirtschaft, reist transkontinentale Eisenbahnlinien entlang und besucht südafrikanische Bergleute in Goldminen. Fast die Hälfte von Amriths Band nimmt freilich die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ein, in dem der Historiker sowohl die rasante Steigerung menschlicher Lebensbedingungen (vgl. Angus Deatons „The Great Escape“) als auch die sich mehrenden Kipppunkte des globalen Klimas in den Vordergrund rückt. In lebendiger Sprache erzählt Amrith auch im Kleinen stets vom Großen und verknüpft seine Knotenpunkte zu einer Globalgeschichte von Mensch-Umwelt-Beziehungen, die Verflechtungen imperialer Expansionen, fossilen Gesellschaftsweisen und globalen Ungleichheiten sichtbar macht. Zur Bewältigung der gegenwärtigen Herausforderungen komme man schlussendlich nicht um neue Visionen des planetaren Zusammenlebens herum, die im Kern auch ein Eingeständnis der menschlichen Verwundbarkeit beinhalten und sich von der Illusion zivilisatorischer Unterwerfung der Natur verabschieden: „Irgendwann einmal war alle Geschichte Umweltgeschichte. Sie ist es immer noch.“